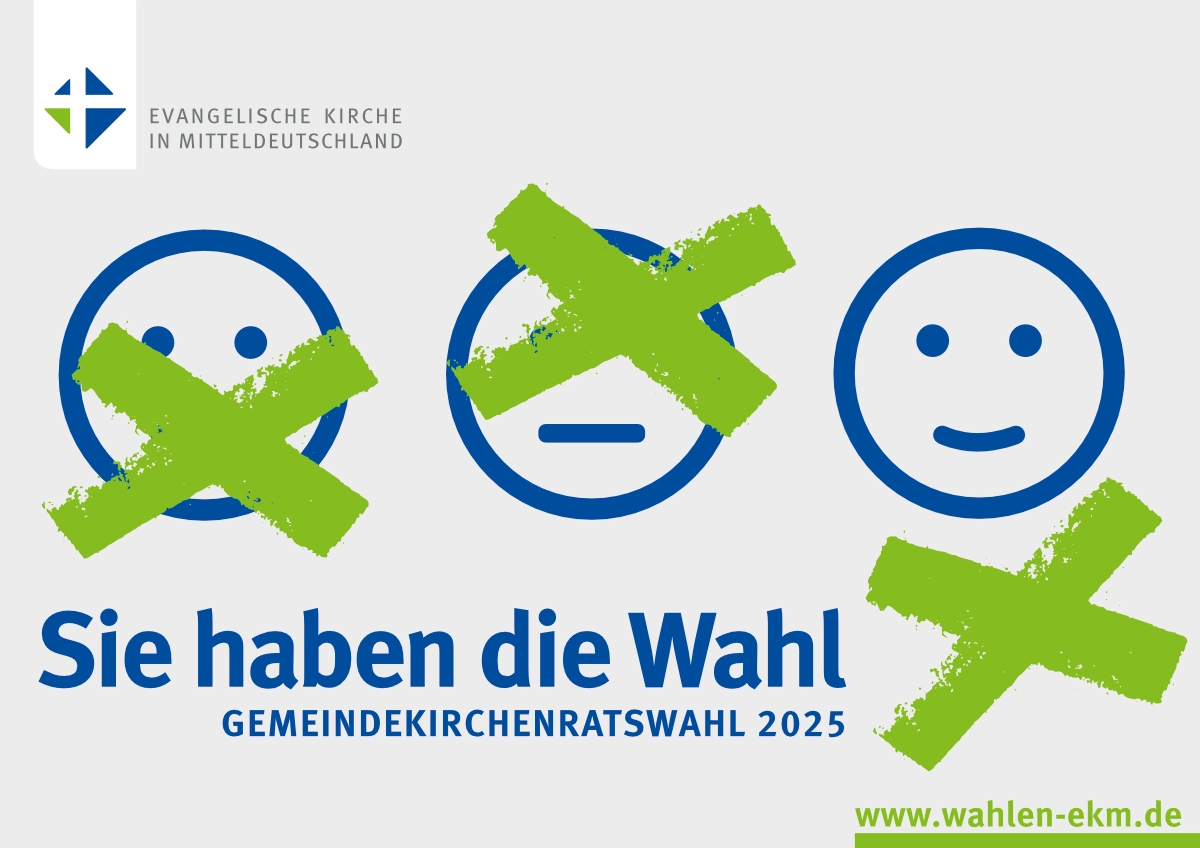Erinnerung, Gedenken, Hoffnung
Ein großes Zelt ist aufgespannt, Stühle aufgereiht in überschaubaren Blöcken.
Die Menschen, die Platz genommen haben, schauen auf ein rotes Backsteingebäude des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Am 27. Januar 1945, vor 80 Jahren, ist es von Soldaten der Roten Armee befreit worden.
Am 27. Januar 2025 sind fünfzig Überlebende gekommen, dazu hochrangige Staatsgäste, Regierungschefs, Repräsentantinnen und Repräsentanten von Königshäusern und mindestens fünfzig junge Menschen. Nachdem vorrangig Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihre Erinnerungen mit den Versammelten geteilt haben und einer von ihnen, Leon Weintraub, insbesondere junge Menschen aufgefordert hat, wachsam und sensibel zu sein in dieser heutigen Welt, in der es so schwer ist, zu unterscheiden, sollen Kerzen aufgestellt werden – zuerst von den Überlebenden.
Da ist es irritierend zu sehen, dass nun eine Reihe junger Menschen feierlich mit einem Licht nach vorn ins Zelt schreitet. Enkel? Urenkel? Verwandte? Übernehmen sie stellvertretend das Abstellen des Lichtes, und die hochbetagten Menschen bleiben auf ihren Plätzen? Als der erste junge Mann am Platz einer Überlebenden ankommt und ihr beim Aufstehen hilft, um sie nach vorn zu begleiten, ist der Ablauf der Zeremonie klar. Fünfzig junge Menschen stützen und unterstützen die ehemaligen Häftlinge auf ihrem Weg der ganz persönlichen Erinnerung. Die meisten stellen die Kerze selber ab, schieben sie noch einmal auf dem Tisch an den für sie richtigen Platz, halten inne, holen tief Luft. Manche bekreuzigen sich. Tränen. Welche Bilder, Gerüche, Klänge werden in diesem Augenblick in den Jüdinnen und Juden wachgerufen, und welche Ängste kommen wieder hoch? Und welche Erinnerung an diesen Tag werden die jungen Menschen für sich abspeichern, um sie im Verlaufe ihres Lebens wachzurufen?
In diesen Tagen wird viel über unsere Erinnerungskultur geredet - sehr kontrovers und sogar, ob wir sie überhaupt noch brauchen. Der Leiter der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, fragte in seiner Rede: „Was haben wir mit der Erinnerung gemacht?“, und fuhr fort: „Wir lehren Geschichte – das sind Fakten. Geschichte kann kein Trauma erzeugen – Erinnerung schon.“
Ganz gleich, welchen Weg wir finden, um nicht zu vergessen, um sensibel und aufmerksam zu machen, es ist wichtig, dass wir auch den Weg der Erinnerung gehen. Das schlimmste wären Gleichgültigkeit und Schweigen und Verharren in unserer Komfortzone.
Klar ist auch, es ist nicht einfach. Es gibt keine einfachen Lösungen, kein Schwarz-Weiß. Wir spüren immer schmerzlicher, dass wir einander nicht mehr überzeugen, ja, dass wir uns – gefühlt – in anderen Welten aufhalten. Aber wollen wir das wirklich? Ich will es nicht! Die Überlebende Tova Friedman, die sich mit ihrer Mutter unter einem Leichenberg versteckt hatte, schloss ihre Rede am Holocaustgedenktag mit den Worten: „Wir beten für Hoffnung. Das muss Teil unseres täglichen Lebens sein“.
Christine Behrend, Pastorin in Ilmenau-Unterpörlitz und Klinikseelsorgerin